Praxis in der Automatisierung
Wo KI sinnvoll unterstützt: von Anomaliedetektion über Assistenz beim Testen bis zur Qualitätssicherung.
Grundlagen und Einordnung für die industrielle Praxis
Wir nutzen KI zur Erstellung technischer Spezifikationen, zur Unterstützung von Programmierlogik (soweit Siemens-Software dies erlaubt), für Handbücher und Bedienungsanleitungen sowie für Testumgebungen unserer Programme. Die Einbindung in laufende Anlagen, insbesondere zur Anomalieerkennung, ist in Vorbereitung.
Künstliche Intelligenz basiert auf einem einheitlichen Grundprinzip: Ein Modell wird mit sehr großen Datenmengen trainiert und lernt daraus, Muster zu erkennen und Wahrscheinlichkeiten vorherzusagen. Je nach Art der Eingangsdaten entstehen unterschiedliche Modelle:
Allen Modellen gemeinsam ist der gleiche Ablauf: Zunächst erfolgt eine Eingabe, zum Beispiel ein Text, ein Bild oder ein Audiostrom. Danach wirkt eine unsichtbare Vorgabe, oft als System-Prompt bezeichnet, die Rolle oder den Kontext festlegt. Anschließend verarbeitet das neuronale Netz die Daten, erkennt Muster und berechnet Wahrscheinlichkeiten. Am Ende entsteht eine Ausgabe in einer für den Menschen verständlichen Form, sei es als Text, Bild, Sprache, Musik oder Analyse.
Damit wird klar: KI denkt nicht, sondern berechnet sehr präzise, was am wahrscheinlichsten passt. Aus demselben Grundprinzip entstehen Systeme, die Texte schreiben, Bilder entwerfen, Sprache verstehen, Audio erzeugen oder Videos analysieren.
Neben den Trainingsdaten spielt der sogenannte System-Prompt eine zentrale Rolle für die Arbeitsweise von KI-Modellen. Er ist so etwas wie ein unsichtiger Startbefehl, der der KI vorgibt, in welcher Rolle oder mit welchem Verhalten sie antworten soll.
Ein Sprachmodell kann mit demselben Wissensstand sehr unterschiedliche Ergebnisse liefern, abhängig davon, wie es durch den Prompt eingestellt wird. Ein und derselbe Satz verändert sich stark, je nach Rolle:
def sunset():
return "Die Sonne geht am Abend unter."
Damit wird deutlich: Der System-Prompt lenkt die Ausgabe, auch wenn das zugrundeliegende Modell immer dasselbe ist.
Für den praktischen Einsatz bedeutet das: Durch die richtige Vorgabe kann eine KI sachlich, kreativ, juristisch, technisch oder unterhaltsam antworten, je nachdem, welche Perspektive gerade gebraucht wird.
Du bist ein erfahrener Ingenieur für Automatisierungstechnik.
Deine Aufgabe ist es, technische Dokumentationen klar, strukturiert
und normgerecht zu verfassen. Verwende präzise Fachbegriffe,
einheitliche Gliederung und eine sachliche Ausdrucksweise.
Damit eine KI sinnvoll antworten kann, muss sie wissen, worüber gerade gesprochen wird. Dieses aktuelle Gespräch oder der Text, der analysiert wird, passt aber nicht unbegrenzt in das Modell. Stattdessen gibt es ein Kontextfenster, eine Art Arbeitsbereich, in dem die letzten Sätze, Absätze oder Seiten verfügbar sind.
Alles, was innerhalb dieses Fensters liegt, kann die KI direkt berücksichtigen. Informationen, die darüber hinausgehen oder bereits hinausgeschoben wurden, sind für das Modell nicht mehr sichtbar. Es erinnert sich nicht wie ein Mensch, sondern verarbeitet nur, was aktuell im Fenster liegt.
Wenn eine Frage gestellt wird, zu der keine passenden Informationen im Kontext vorhanden sind, versucht die KI trotzdem eine Antwort zu geben und greift dabei auf Muster aus ihren Trainingsdaten zurück. Genau daraus entstehen die sogenannten Halluzinationen: Antworten, die sprachlich plausibel klingen, aber faktisch falsch oder erfunden sind.
Für Anwender heißt das: Je besser man den Kontext steuert, zum Beispiel durch präzise Eingaben oder zusätzliche Dokumente, desto verlässlicher wird die Antwort.
Streng genommen besitzt eine KI kein eigenes Bewusstsein. Sie rechnet Wahrscheinlichkeiten und erkennt Muster, aber sie weiß nichts im menschlichen Sinn. Trotzdem gibt es verschiedene Verfahren, mit denen sich ihr Wissenshorizont und ihre Leistungsfähigkeit erweitern lassen:
Zusammengefasst: Man kann das Bewusstsein einer KI nicht im philosophischen Sinn erweitern, aber man kann ihren Wissenskontext und ihre Fähigkeiten gezielt ausbauen, entweder durch externe Anbindung (RAG), leichte Anpassungen (LoRA) oder erneutes Training.
Kurz gesagt: Nein, zumindest nicht in absehbarer Zeit.
Eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) oder ein Programmable Logic Controller (PLC) erfüllt Aufgaben, die sich grundlegend von den Möglichkeiten eines KI-Modells unterscheiden. Eine Steuerung arbeitet deterministisch, sie führt ihre Zyklen in Millisekunden präzise aus und liefert stets dasselbe Ergebnis. Genau das ist in der Automatisierung entscheidend, wo Prozesse zuverlässig und vorhersehbar gesteuert werden müssen.
Hinzu kommt, dass Steuerungen strengen Normen und Sicherheitsanforderungen unterliegen. Systeme in der Industrie müssen nachweisbar sicher, validierbar und zertifizierbar sein. Ein KI-Modell arbeitet hingegen probabilistisch. Es errechnet Wahrscheinlichkeiten und kann je nach Kontext zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Diese Eigenschaften sind wertvoll für Analysen, aber sie erfüllen nicht die Anforderungen an ein sicherheitskritisches Echtzeitsystem.
Auch die Robustheit unterscheidet sich. Steuerungen sind dafür ausgelegt, jahrzehntelang unter rauen Bedingungen zuverlässig zu laufen, während KI-Modelle auf Hochleistungsrechnern mit spezieller Hardware betrieben werden und regelmäßig gewartet oder aktualisiert werden müssen.
Das bedeutet jedoch nicht, dass KI in der Automatisierung keinen Platz hat. Sie kann Steuerungen sinnvoll ergänzen, zum Beispiel in der Anomalieerkennung oder im Predictive Maintenance, wenn es darum geht, Abweichungen in Prozessdaten frühzeitig zu erkennen. Ebenso kann sie in der Optimierung eingesetzt werden, etwa um Energieverbräuche zu reduzieren oder Produktionspläne dynamisch anzupassen. Auch in der Unterstützung von Ingenieuren und Technikern bietet KI Mehrwert, etwa beim Erstellen von Funktionsbausteinen oder bei der schnellen Einordnung von Fehlermeldungen.
Fazit: Eine SPS oder PLC ist ein sicherheitskritisches Echtzeitsystem. Ein KI-Modell ist ein leistungsfähiger Mustererkenner und Optimierer. Beide Technologien sind nicht austauschbar, können sich aber in der Praxis wirkungsvoll ergänzen.
Die Antwort hängt stark davon ab, wie KI eingesetzt wird. Grundsätzlich gibt es drei typische Formen:
Damit ist klar: Die Sicherheit beim Arbeiten mit KI hängt weniger von der Technologie selbst ab, sondern von der gewählten Betriebsform. Von Cloud-Chatbots über hybride API-Lösungen bis hin zum vollständigen Offline-Betrieb gibt es unterschiedliche Stufen, die je nach Anforderungen an Datenschutz und Infrastruktur ausgewählt werden können.
Ein Agent ist eine Erweiterung eines KI-Modells, die nicht nur Antworten gibt, sondern auch eigenständig Aufgaben ausführen kann. Während ein Sprachmodell in erster Linie Text versteht und erzeugt, verbindet ein Agent dieses Sprachverständnis mit Handlungslogik und zusätzlichen Werkzeugen.
Damit lassen sich Aufgaben automatisieren, die über reine Textgenerierung hinausgehen. Ein Agent kann beispielsweise Informationen aus verschiedenen Quellen zusammentragen, Zwischenschritte planen, Ergebnisse aufbereiten und sie dann in eine Handlung umsetzen. In der Automatisierungspraxis können Agenten eingesetzt werden, um Systeme zu überwachen, Daten auszuwerten oder Ingenieure mit automatischen Vorschlägen und Dokumentationen zu unterstützen.
Ein Agent ist also kein neues Modell, sondern eine umgebende Struktur, die ein Modell gezielt in bestimmte Arbeitsabläufe einbettet und dadurch praktische, wiederholbare Aufgaben übernimmt.
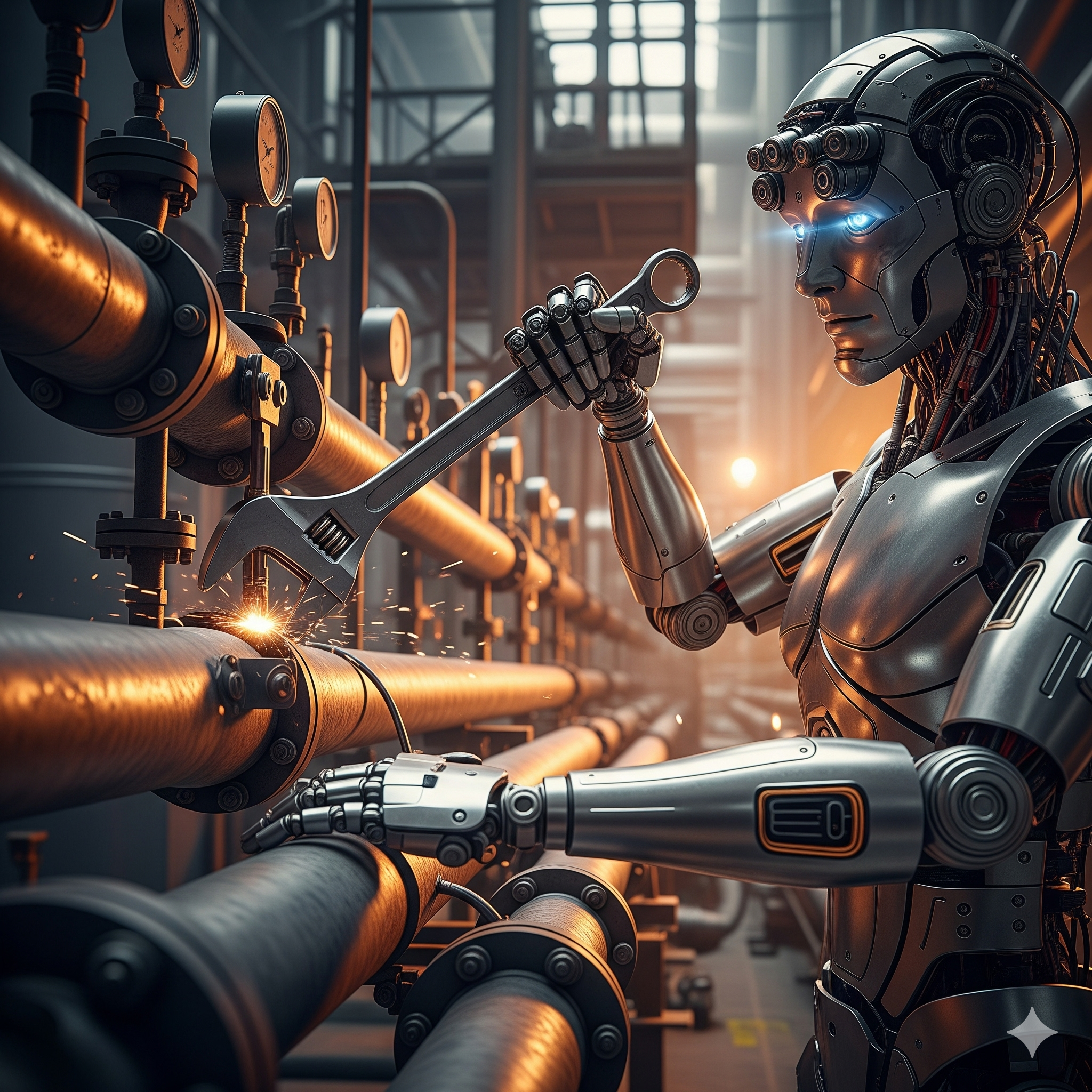
Wo KI sinnvoll unterstützt: von Anomaliedetektion über Assistenz beim Testen bis zur Qualitätssicherung.
Deterministische Steuerungen vs. probabilistische Modelle: Anforderungen an Safety, Validation und Auditierbarkeit.
Typische Architekturen: Datenanbindung, Edge-Inferenz, Monitoring, Protokolle und Lebenszyklus der Modelle.
Sie möchten konkrete Einsatzfelder für Ihre Anlage prüfen oder eine bestehende Lösung evaluieren? Sprechen Sie uns an.